Erfolge ohne Eile
![{[downloads[language].preview]}](https://www.rolandberger.com/publications/publication_image/big_ta43_de_cover_j_download_preview.jpg)
In der neuen Ausgabe des Think:Act Magazins erkunden wir die Vorteile eines ruhigeren Tempos und lernen vom Erfolg entschleunigter Unternehmen.

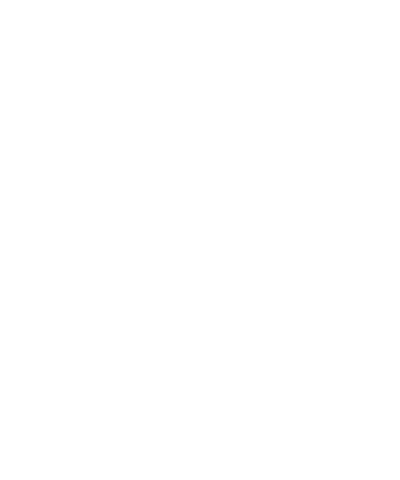
by Geoff Poulton
Fotos von Julia Sellmann
Das moderne Leben erscheint bisweilen wie eine Achterbahnfahrt im Zeitraffer. der Effizienzdruck greift zunehmend auf das Privatleben über und hinterlässt eine weitverbreitete Erschöpfung. Das tut auch der Wirtschaft nicht gut. Inzwischen bildet sich ein Gegenentwurf heraus. Forscher und Manager setzen auf die Vorzüge einer strategischen Entschleunigung, die auch Unternehmen helfen kann.

Für Carl Honoré, kam die Einsicht auf dem Flughafen Fiumicino in Rom. Er blätterte in einer Zeitung, als ihm die Überschrift "Gutenachtgeschichte in einer Minute" ins Auge stach. "Könnte das die Antwort sein?", fragte sich Honoré. Sein damals zwei Jahre alter Sohn mochte zum Einschlafen langsame, mäandernde Geschichten, doch der Schriftsteller ertappte sich immer öfter dabei, wie er das Ritual hektisch abspulte. Er hatte ja stets noch jede Menge anderer Dinge zu erledigen. Doch dann fragte er sich: "Bin ich eigentlich völlig verrückt geworden?" Als er im Flugzeug saß und weiter darüber nachdachte, stellte er fest, dass alle um ihn herum geradezu besessen davon waren, möglichst viele Erledigungen und Aktivitäten in einen Tag zu packen und von einer Sache zur nächsten zu hetzen, bis sie völlig erschöpft waren.
Honoré wollte herausfinden, ob es nicht besser ist, sich dem zunehmenden Zeitdruck zu widersetzen. Seine Erkenntnisse trug er 2004 in dem Buch In Praise of Slow zusammen. Zwei weitere Bücher und ein TED-Vortrag folgten, Honoré aber fühlte sich wie ein Rufer in der Wüste. Heute, 20 Jahre nach der Veröffentlichung seines ersten Buches zu dem Thema, haben sich die Dinge verändert – nicht nur zum Besseren. So hat uns die technologische Entwicklung neue digitale Geräte zur Dauerablenkung beschert. Zugleich aber breitet sich eine Gegenbewegung aus, eine Revolution der Entschleunigung, wenn man so will, die auf breiten Widerhall in der Gesellschaft stößt.
Eine wachsende Bewegung namhafter Autoren hebt seit ein paar Jahren die Vorzüge eines entschleunigten Lebens hervor. Bücher wie Jenny Odells Nichts tun, Oliver Burkemans 4000 Wochen oder Cal Newports Slow Productivity sind internationale Bestseller. Sie rufen nicht zu einem Leben im Schneckentempo auf. Tempo hat auch Vorteile. Medizinische Innovationen wie Impfstoffe können Leben retten und ein schnelles, geschäftiges Leben mag manch einer als sinnstiftend empfinden.
Im modernen Leben gibt es jedoch immer noch etwas mehr zu tun, erinnert uns Buchautor Burkeman: "Ständig danach zu streben, die persönlichen Kapazitäten und Fähigkeiten auszubauen, immer mehr Dinge zu erledigen, scheint den Sinn eines erfüllten, produktiven Lebens zu verfehlen", sagt er. Im Mittelpunkt steht dabei unser Verhältnis zur Zeit und wie wir sie als Menschen verbringen – etwas, das sich im Laufe der Jahrhunderte stark verändert hat.

Wir sind besessen von der Zeit. In seinem Buch 4000 Wochen widmet sich Oliver Burkeman Phänomenen, die mit der Zeit zusammenhängen. Sein Titel etwa spielt darauf an, dass wir nur rund 4.000 Wochen auf der Erde verbringen, wenn wir 80 Jahre alt werden. Das hört sich nach einer beunruhigend kurzen Zeitspanne an. "Leben ist Zeitmanagement", schreibt Burkeman. Dennoch konzentriere sich das Zeitmanagement meist darauf, wie man so viele Aufgaben wie möglich erledigen kann. "Die Welt ist voller Wunder", sagt er. Und doch scheinen die Produktivitätsgurus nicht zu begreifen, dass "der eigentliche Sinn all unseres geschäftigen Tuns darin bestehen könnte, mehr von diesen Wundern zu erleben".
Vor der Industrialisierung wurde der Tagesablauf noch weitgehend von Naturphänomenen wie den Gezeiten, von Tageslicht und vom Wetter bestimmt. Dann kam die industrielle Revolution, die seit der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts unser Verständnis von Zeit massiv veränderte. Fabrikanten brauchten für die Produktion an den Maschinen stark synchronisierte Belegschaften, die Arbeitszeit wurde zu einer Ware und einer Art Währung, die es auszugeben und zu nutzen galt. Fortschritt und Tempo wuchsen zusammen. Und so ging es weiter bis ins 20. Jahrhundert, mit bahnbrechenden Errungenschaften wie dem Montageband von Ford, das die Produktionszeit für ein Automobil auf nur noch 90 Minuten reduzierte.
In ihrem Buch Zeit finden: Jenseits des durchgetakteten Lebens bemerkt Jenny Odell, dass sich unsere Effizienz-Besessenheit seit dieser Zeit von der Arbeitswelt auf unser alltägliches Leben ausgedehnt hat. Sie bezieht sich auf ein Werk des Sozialpsychologen Donald Laird aus dem Jahr 1925, Increasing Personal Efficiency. Das Buch ist von einer kulturellen Fixierung auf Geschwindigkeit, Kontrolle und zielgerichtete Aufgaben durchdrungen. Alles Unnütze sollte beseitigt werden. Und plötzlich tauchte in jener Zeit die Sprache der Fabrikmanager auch in der privaten Lebenswelt und im Kontext persönlicher Themen auf.
In den vergangenen Jahrzehnten haben die digitalen Innovationen den Druck noch erhöht. Im Geschäftsleben geht es oft nicht mehr um Stunden und Minuten, sondern um Sekunden oder noch weniger. Amazon verliert bei nur 100 Millisekunden Latenzzeit auf seiner Website 1 % seines Umsatzes. Google fand schon 2006 heraus, dass jede halbe Sekunde Latenzzeit den Datenverkehr der Suchmaschine um 20 % reduziert.
Google fand schon 2006 heraus, dass jede halbe Sekunde Latenzzeit den Datenverkehr der Suchmaschine um 20 % reduziert.
100 Jahre nach Donald Lairds Buch ist unsere Leistungsbesessenheit fest in unserem Arbeits- und Privatleben verankert. Studien belegen, dass die "Produktivitätsorientierung" inzwischen auch unsere Freizeit prägt. Möglicherweise lässt uns die Technik sogar glauben, dass die Zeit schneller vergeht, als sie es tatsächlich tut. Forschungen an der australischen James Cook University legen nahe, dass wir mit Smartphones und Computern zwar effizienter Informationen verarbeiten. Zugleich gaukeln wir dem Gehirn jedoch vor, dass die Zeit schneller vergeht. Wir arbeiten so zwar tatsächlich schneller, fühlen uns aber auch stärker unter Druck.
So sollte es eigentlich nicht kommen. Ökonomen wie John Maynard Keynes glaubten, die technischen Quantensprünge des 20. Jahrhunderts würden zu einem gemächlicheren Lebensrhythmus beitragen. Keynes sagte 1930 voraus, dass die meisten Menschen in 100 Jahren nur noch 15 Stunden pro Woche arbeiten werden. Seit den 1970er-Jahren hat sich die Arbeitszeit indes kaum verändert. Anstatt in Muße leben wir heute mit einem technologischen Paradoxon: Die (nur scheinbare) Freiheit, die uns Smartphones und Anwendungen wie Zoom bieten, stehen in keinem gesunden Verhältnis zu mehr Stress, Ablenkung, Überforderung und Burn-outs.
Burkeman verweist auf die Ironie, dass Technologie uns zwar an sich helfen könne, am Ende aber alles meist nur schlimmer mache. "Die Technik bietet viele Möglichkeiten, um mit all dem Kram fertig zu werden, den es im modernen Leben zu tun gibt", sagt er. "Ich glaube aber, man fühlt sich besonders desillusioniert, wenn man diese Apps und Geräte in sein Leben integriert und sich dann trotzdem überfordert fühlt."

Nirgends sonst ist das Problem so verbreitet wie in der Arbeitswelt, vor allem in den sogenannten Wissensberufen. Laut Cal Newport, Informatiker an der Georgetown University, liegt das hauptsächlich an einer überkommenen Vorstellung von Produktivität. In seinem Buch Slow Productivity befasst sich der Forscher mit der Frage, warum hohe Leistungsbereitschaft heute so oft in einem Burn-out endet. Unser Produktivitätskonzept habe sich überlebt, so Newport. Arbeitnehmer sähen sich zunehmend mit nur zwei Möglichkeiten konfrontiert: Entweder man macht mit beim Betriebsamkeitskult, oder man lässt jeden beruflichen Ehrgeiz fahren.
Wie ist es so weit gekommen? Bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts folgte die Vorstellung von Produktivität einer einfachen Regel: Wachse oder mache ein Produkt effizienter, um die Gewinne zu steigern. Als jedoch immer mehr Kopfarbeiter in die Büros strömten, brauchte man neue Methoden, um die Produktivität zu messen. Unternehmen nutzten sichtbare Aktivitäten als Indikator für die tatsächliche Produktivität. Wegen dieser "Pseudoproduktivität" (Newport) wird auch heute noch in Büroumgebungen an der 40-Stunden-Woche festgehalten, obwohl sie ursprünglich dazu gedacht war, die Fabrikarbeit zu regeln. Deshalb verspürten Mitarbeiter den Drang, beschäftigt zu tun, sobald der Vorgesetzte in der Nähe war.
Betriebsamkeit ist so zu einer Art Statussymbol geworden. Studien zeigen, dass sich Menschen, die viel zu tun haben (oder zumindest so erscheinen), für wichtig halten. Adam Waytz, Professor für Management an der Kellogg School of Management an der Northwestern University, erklärt, dass wir die Fleißigen "in moralischer Hinsicht bewundernswert" finden, unabhängig von ihrer Leistung. "Die Systeme, in denen die meisten Menschen arbeiten, verlangen Produktivität, Wachstum und Gewinn. Verlangt wird im Grunde, dass wir andauernd beschäftigt sind – oder zumindest so tun", sagt der Psychologe. Unablässige Betriebsamkeit und steter Produktivitätsdruck sind jedoch nicht nur schlecht für unser Wohlbefinden, auch die Qualität der Arbeit leidet.
Wie sehr wir von Effizienz besessen sind, zeigt sich in unserer Neigung zum Multitasking. Doch Multitasking drückt die Produktivität um bis zu 40 %. Das reflexartige Überprüfen von Messenger-Diensten wie WhatsApp lenkt unser Gehirn ab. Im Schnitt dauert es 15 Minuten, bis wir uns nach einer Ablenkung wieder auf unsere eigentliche Aufgabe konzentrieren können.
"Die Systeme, in denen wir arbeiten, verlangen Produktivität. Deshalb müssen wir andauernd beschäftigt sein – oder zumindest so tun."
Eine Mischung aus Ablenkung und einem Mangel an geeigneten Produktivitätskennziffern erschwert, was Newport "tiefgründige Arbeit" nennt. Wir wenden uns lieber oberflächlichen, konkreten Aufgaben zu. "Es ist einfacher, sich in E-Mail-Verläufe zu vertiefen und Anrufe abzuarbeiten, als den Kopf anzustrengen und eine neue Strategie zu entwickeln", schreibt er in Slow Productivity. Ein hohes Arbeitspensum und ein starrer Zeitplan sind schlecht fürs Gehirn. Neurowissenschaftler unterscheiden zwei grundlegende Funktionsweisen: Das "exekutive Kontrollnetzwerk" leitet das Gehirn bei der Ausführung bestimmter Aufgaben an. Im "Standardmodusnetzwerk" ist das Gehirn im Ruhezustand.
Letzteren brauchen wir, um zu träumen, uns etwas vorzustellen oder um über Vergangenheit und Zukunft nachzudenken. Im Ruhezustand wird auch die Kreativität gefördert. Beide Netzwerke sollten harmonisch zusammenarbeiten. Zu viel Stimulation kann dazu führen, dass der Standardmodus ins Hintertreffen gerät, während die Exekutivfunktion von Aufgabe zu Aufgabe springt.
Aus diesem Teufelskreis auszubrechen und Ruhephasen einzuplanen, ist nicht leicht. Zum Teil liegt das daran, dass wir uns an diese Art zu leben und zu arbeiten gewöhnt haben. "Wenn wir immer wieder das Gleiche tun und sehen, wie andere das auch tun, hört unser Gehirn auf, das wahrzunehmen oder infrage zu stellen", sagt Tali Sharot, Neurowissenschaftlerin am University College London und am MIT. "Etwas könnte Stress verursachen, aber man weiß nicht, was es ist. Habitualisierung bedeutet, dass der Stress mit der Zeit abnehmen kann, aber noch da ist. Erst wenn man die Ursache für den Stress los wird, bemerkt man, wie groß sein negativer Einfluss war", erklärt sie.
Manchmal sind grundlegende Veränderungen der einzige Ausweg. Devon Price ist Sozialpsychologe an der Loyola University Chicago und Autor von Laziness Does Not Exist. In seinem Buch untersucht er, warum wir trotz der Tatsache, dass wir mehr arbeiten als je zuvor in der Geschichte, oft das Gefühl haben, es sei nicht genug. Jetzt könnten sich die Dinge endlich ändern, meint Price. Die Generation, die seit der Finanzkrise 2008 erwachsen geworden ist, "glaubt nicht mehr an die Mythen, die vielen von uns Älteren eingetrichtert worden sind. Sie glaubt nicht an den Wert harter Arbeit." Deshalb betrachtet sie Leiden bei der Arbeit nicht mehr als moralischen Wert an sich. Oder, wie Carl Honoré es ausdrückt: "Jüngere Leute schauen auf die älteren Generationen und fragen: Okay, aber was hast du nun von deiner 80-Stunden-Woche gehabt? Rückenschmerzen und drei Scheidungen, richtig? Und wahrscheinlich eine Herzkrankheit."

Zahlreiche Lösungsansätze liegen bereits vor. Auf organisatorischer Ebene ist es wichtig, Situationen zu erkennen, in denen man das Tempo drosseln sollte. In ihrem Buch The Friction Project weisen Bob Sutton und Huggy Rao von der Stanford University darauf hin, dass "strategische Entschleunigung" zu überlegteren Entscheidungen und produktiverer Arbeit führen kann und die Mitarbeiter sich zufriedener fühlen. Sie identifizieren zahlreiche Gelegenheiten, in denen kluge Manager ihre Mitarbeiter dazu ermutigen sollten, einen Gang runterzuschalten. Dazu zählen Momente vor wichtigen Entscheidungen, kreative Prozesse und Phasen, in denen komplexe Probleme bearbeitet werden. Entschleunigen kann auch hilfreich sein bei ethisch relevanten Entscheidungen.
Auf individueller Ebene gibt es ebenfalls mehrere Ansätze für ein besonneneres Arbeitstempo: von regelmäßigen kurzen Pausen über Freitage ohne Meetings bis hin zur Vier-Tage-Woche. Natürlich werden für unterschiedliche Charaktere, Teams, Abteilungen und Unternehmen verschiedene Ansätze gut funktionieren. Doch eines ist klar: Die ständige Arbeit am Limit schadet nur.
Der österreichische Designer und Künstler Stefan Sagmeister verfolgt einen konsequenten Ansatz, aber das Prinzip bleibt dasselbe: Alle sieben Jahre verlässt der 62-Jährige sein New Yorker Studio, in dem er mit Größen wie den Rolling Stones, HBO und dem Guggenheim-Museum gearbeitet hat, für ein Sabbatical. Während seiner Auszeit widmet sich Sagmeister seinen kreativen Interessen, vom Möbelbau bis zum Filmemachen, und er entwickelt neue Ansätze für seine kommerzielle Arbeit.
"Ausnahmslos alle haben gesagt, dass [ein Sabbatical] eines der besten Dinge war, die sie je in ihrem Leben gemacht haben."
Für die meisten Unternehmer und Manager ist die Idee, ein Jahr lang die Arbeit einfach mal ruhen zu lassen und danach wieder einzusteigen, eine herausfordernde Vorstellung. Sagmeister ist da keine Ausnahme. "Ich war sehr besorgt", erinnert er sich. "Es war 1999, unser Studio war sieben Jahre alt, der erste Internet-Boom in vollem Gange und jeder war dabei, viel Geld zu verdienen. Es schien unprofessionell, ein Jahr auszusteigen, um neue Dinge auszuprobieren." Er fürchtete, das Studio würde alle Kunden verlieren. "Aber keine meiner Befürchtungen ist eingetreten."
In diesem Jahr wird Sagmeister zum vierten Mal zwölf Monate Auszeit nehmen. Jedes Mal ist er mit neuen Fähigkeiten, neuen Ideen und vor allem mit dem Gefühl zurückgekehrt, dass seine Arbeit nicht nur ein Job, sondern eine Berufung ist. Für Sagmeister ist die Dauer der Pause weniger entscheidend als die Verpflichtung, das zu tun, was einen wirklich interessiert – und sich den Raum zu geben, Dinge auszuprobieren. "Ich habe inzwischen mit Dutzenden von Menschen gesprochen, die ein Sabbatical nehmen. Ausnahmslos alle haben gesagt, dass es eines der besten Dinge war, die sie je in ihrem Leben gemacht haben."
Eine aktuelle Studie von Forschern aus Harvard, der University of Notre Dame und der University of Washington bestätigt die Erfahrung Sagmeisters. Sie zeigt, dass Sabbaticals positive Veränderungen bei den Mitarbeitern auslösen. Kein Wunder also, dass immer mehr Arbeitgeber Sabbaticals anbieten. Die Forscher geben den Unternehmen einen klaren Rat: "Wenn Sie Sabbaticals ermöglichen, bevor Beschäftigte ausgelaugt sind, kehren die meisten mit neuer Energie und größerer Klarheit darüber zurück, wie sie ihren Teil zum Unternehmenserfolg beitragen können." Wer hat nicht gern zufriedene und gesunde Mitarbeiter? Aber wie wirkt sich das auf die Produktivität und Gewinne aus? Eindeutige Beweise für einen Zusammenhang zwischen dem Wohlbefinden der Mitarbeiter und dem Unternehmenserfolg findet man selten, aber es gibt durchaus Anhaltspunkte.
Im Jahr 2019 führte die University of Oxford gemeinsam mit dem britischen Telekommunikationsunternehmen BT über sechs Monate ein Forschungsprogramm durch. Dabei wurde festgestellt, dass die Produktivität der Beschäftigten um 13 % steigt, wenn sie zufrieden sind. Eine Meta-Analyse derselben Forscher ergab, dass die Zufriedenheit der Beschäftigten stark mit der Produktivität und etwas schwächer mit der Rentabilität korreliert.
Es gibt sogar Hinweise darauf, dass sich ein bewusst bedächtiger ausgerichtetes Vorgehen auszahlen kann. In einer Studie der Harvard University gemeinsam mit der Zeitschrift The Economist zeigte sich im Jahr 2010, dass Unternehmen, die "ständig schnell arbeiten und sich auf die Maximierung der Effizienz konzentrieren", geringere Umsätze und Gewinne erzielten als Unternehmen, die auf strategische Entschleunigung setzen.
"Spätestens seit den 1980er-Jahren wissen wir, dass kürzere und flexiblere Arbeitszeiten Mitarbeiter zufriedener machen."
Zunehmend beliebt wird die Vier-Tage-Woche. Nach Island, Spanien, Belgien, Großbritannien und Südafrika erproben seit Februar 2024 auch Unternehmen in Deutschland die wöchentliche Arbeitszeitverkürzung. Große Konzerne wie Microsoft und Unilever haben das Konzept bereits in ausgewählten Märkten getestet. Der Ansatz variiert im Detail, das am weitesten verbreitete Konzept ist das 100-80-100-Modell, bei dem 80 % der geleisteten Arbeitsstunden zu 100 % entlohnt werden, während die Produktivität bei 100 % gehalten wird. Weniger auf die geleisteten Arbeitsstunden und dafür mehr auf die Ergebnisse zu achten, erhöht offenbar die Produktivität.
die Vier-Tage-Woche ist gewiss nicht auf alle Branchen übertragbar, aber die bisherigen Erfahrungen sind ermutigend. 61 britische Unternehmen nahmen im Jahr 2022 an der bisher größten Untersuchung dazu teil. Sie zeigte, wie Unternehmen die Arbeitszeit verkürzen, ohne ihre Ziele zu gefährden. "Konzentrationsphasen" für die Beschäftigten wurden eingeführt, E-Mail-Etiketten erneuert und Besprechungen kürzer und straffer gestaltet. Viele Büroangestellte kennen das Gefühl, mehr Zeit damit zu verbringen, über ihre Arbeit zu reden, als sie tatsächlich zu erledigen, während sie durch Anrufe und E-Mails fortwährend abgelenkt werden.
Natürlich sind Versuche in dieser Größenordnung nur bedingt aussagekräftig. Aber ist es nicht an der Zeit, einen Richtungswechsel einzuleiten? Devon Price ist skeptisch: "Ich glaube, die Wirtschaft wird so lange gegen das Unvermeidliche ankämpfen, bis sie die Umstände auf einen anderen Kurs zwingen. Spätestens seit den 1980er-Jahren wissen wir, dass kürzere und flexiblere Arbeitszeiten Mitarbeiter zufriedener machen."
Die Spannungen am Arbeitsplatz kann man kaum mehr übersehen. Arbeitnehmer setzen sich gegen den Status quo zur Wehr. Honoré sagt, er höre ständig von CEOs, dass das Thema ganz oben auf der Agenda stehe. Die Reaktionen seien zweigeteilt: Entweder seien die Leute erstaunt, dass endlich etwas passiert, oder sie seien verzweifelt angesichts der vermeintlich mangelhaften Arbeitsmoral der überempfindlichen jungen Leute.

Je älter wir werden, desto bewusster gehen wir mit unserer Zeit um. "Wenn wir jung sind, neigen wir dazu, die Zukunft als unendlich zu empfinden, während ältere Menschen erkennen, dass Zeit begrenzt und kostbar ist", sagt die UCLA-Professorin Cassie Mogilner Holmes, die in ihrem Buch Happier Hour den Zusammenhang zwischen Zeit und Glück erkundet. Sie hat beobachtet, dass Jüngere durch die Corona-Lockdowns heute die Zeit tendenziell mehr wie Ältere wahrnehmen. Das erkläre, warum Arbeitnehmer heute stärker auf ihre Zeit achten. "Ich glaube, dass es für Arbeitnehmer und Arbeitgeber gut wäre, den Sinn der Arbeit zu erkennen und sich auf Dinge zu konzentrieren, die mehr wert sind, als nur hart zu arbeiten, weil man es eben so macht."
Die Suche nach einem natürlicheren Lebensrhythmus kann ein harter Kampf werden. Denn irgendwann stehen wir vor dem größten Hindernis – uns selbst. Entschleunigung schafft mehr Zeit und Raum, sich mit grundsätzlichen Fragen wie nach dem Sinn des Lebens und der eigenen Identität auseinanderzusetzen. Viel einfacher ist es doch, solchen Gedanken auszuweichen, sich mit Stress und Kleinigkeiten abzulenken. "Aber die Entschleunigung ist die einzige Möglichkeit, ein Leben zu führen, das diesen Namen verdient", sagt Honoré. "Wir haben uns in den letzten Jahrzehnten so weit von dem entfernt, was es heißt, ein Mensch zu sein. Es ist an der Zeit, zu entschleunigen und sich wieder darauf zu besinnen."

![{[downloads[language].preview]}](https://www.rolandberger.com/publications/publication_image/big_ta43_de_cover_j_download_preview.jpg)
In der neuen Ausgabe des Think:Act Magazins erkunden wir die Vorteile eines ruhigeren Tempos und lernen vom Erfolg entschleunigter Unternehmen.
