In Dekaden denken
![{[downloads[language].preview]}](https://www.rolandberger.com/publications/publication_image/ta44_de_cover_download_preview.jpg)
Die aktuelle Think:Act-Ausgabe wirft einen frischen Blick auf die Business-Konzepte der letzten Jahrzehnte – und ihre Bedeutung für die kommenden 20 Jahre.

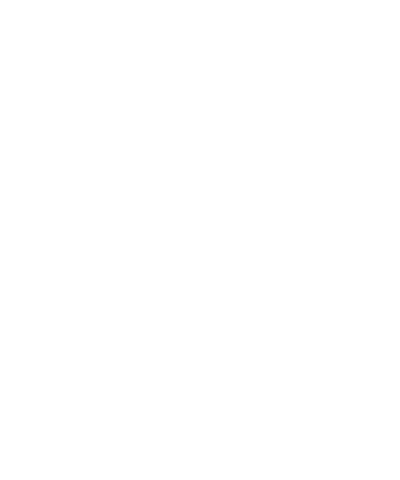
von Grace Browne
Fotos von Roderick Aichinger
Smartphones bieten uns mit einer Fülle von Apps ein Fenster zur Welt in der Hosentasche. Kritiker werfen jedoch immer dringlicher die Frage auf, ob die digitalen Alleskönner dem Menschen mehr schaden als nutzen.
Motorola brachte 1983 das erste Mobiltelefon auf den Markt, das DynaTAC, besser bekannt als der Ziegelstein ("The Brick") – es wog mehr als ein Kilogramm. Je ausgereifter die Technik und je kleiner die Geräte, desto populärer wurden Handys. IBM brachte 1994 mit dem Modell "Simon" das erste Mobiltelefon heraus, das man als eine Art Smartphone bezeichnen konnte. Es verfügte über einen Touchscreen, Fax-, E-Mail- und Kalenderfunktionen, verschwand aber wegen seiner kurzen Akkulaufzeit schon nach einem halben Jahr wieder vom Markt.
Das Blackberry gilt als erstes erfolgreiches Smartphone. Als es 1999 auf den Markt kam, entwickelte es sich schnell zum Statussymbol unter Managern – das Büro in der Hosentasche zeigte, wie extrem beschäftigt man war. Doch schon früh deutete vieles darauf hin, dass die Grenzen zwischen Privat- und Berufsleben verschwammen und die vermeintliche neue Freiheit auch erhebliche Nachteile mit sich brachte. Der Ausdruck "Crackberry" zeigte schon vor fast 20 Jahren die Besessenheit und Sucht, die viele Nutzer der ersten Stunde erfasste. Die Herausgeber des Webster's New World Dictionary kürten "Crackberry" 2006 zum Wort des Jahres.
Ein Jahr später schrieb Jonathan Freedland in The Guardian über seine zwanghafte Beziehung zu seinem Blackberry: "Ich schaute wie gebannt auf das handtellergroße Gerät; mein Blick wanderte ständig in die obere rechte Ecke, um zu sehen, ob das rote Licht blinkte. Wenn ja, war die Neugier unerträglich. Klar, man wusste ja an sich, dass wieder nur Spam oder eine neue Rundmail im Posteingang war. Aber was, wenn vielleicht doch etwas Aufregendes passiert war?"
Das Blackberry war im Nachhinein betrachtet jedoch nur ein laues Lüftchen verglichen mit dem Sturm, den ein Jahr später der Technologiekonzern Apple anfachte. Im Jahr 2007 stellte Steve Jobs das erste iPhone vor, eine damals bahnbrechende Kombination aus Mobiltelefon, iPod und Internet. Ende 2013 hatte bereits jeder fünfte Mensch auf der Erde ein Smartphone in der Tasche. Kevin Roose, Technologie-Kolumnist der New York Times, beschrieb unsere Beziehung zu Smartphones einmal als "Umweltschock auf Artenebene". "Vielleicht entwickeln wir eines Tages ja die richtige biologische Ausstattung, um in Harmonie mit tragbaren Supercomputern zu leben, die all unsere Wünsche erfüllen und uns mit unendlich vielen Stimulationen versorgen", schrieb er. "Aber für die meisten von uns ist es noch nicht so weit."
Nachdem die zwanghafte Beziehung zu den neuen Alleskönnern in der Hosentasche nicht mehr zu leugnen war, kamen neue Sorgen hinzu: Wie beeinflussen sie unsere Arbeit, unsere Beziehungen, unsere Gesundheit – und nicht zuletzt auch unser Gehirn? Lange hielt sich in der Forschung die Annahme, erwachsene Gehirne blieben ein Leben lang unverändert. Hirnforscher konnten jedoch zeigen, dass sich das menschliche Hirn kontinuierlich verändert; sie sprechen dabei von neuronaler Plastizität. Das Gehirn bleibt ein Leben lang empfänglich für äußere Einflüsse.
Immer häufiger ist inzwischen der Begriff "Sucht" im Zusammenhang mit der oftmals obsessiven Nutzung von Smartphones zu hören. Ob die Smartphone-Sucht jedoch der klinischen Definition für die Abhängigkeit von Substanzen wie Alkohol und Opiaten entspricht, bleibt umstritten. Eine Meta-Analyse aus dem Jahr 2022, basierend auf 82 Studien mit 150.000 Teilnehmern, deutet dessen ungeachtet darauf hin, dass bis zu ein Viertel der Bevölkerung durchaus unter einer gewissen Smartphone-Sucht leidet. Anna Lembke, Suchtexpertin an der Stanford University, bezeichnet die smarten Minicomputer sogar als "moderne Injektionsnadel": Jeder Like, jede Nachricht, jedes TikTok-Video löst einen Dopaminschub aus. Der Neurotransmitter verstärkt das Verlangen nach mehr, so beginnt ein Teufelskreis.
Kinder sind heute früh mit Bildschirmen konfrontiert: Eine aktuelle Studie zeigt, dass rund 40 % der Kinder in den USA bereits mit 10 Jahren ein Smartphone besitzen.
Quelle: Common Sense Media
Dieser Kreislauf hat auch neuropsychologische Folgen: Unsere Aufmerksamkeitsspannen werden kleiner. Viele Menschen sind kaum mehr in der Lage, sich auf eine längere Aufgabe zu konzentrieren oder in ein Buch zu vertiefen. Der Drang, aufs Handy zu schauen, ist einfach zu groß. Fachleute nennen das den "Brain-Drain-Effekt". Er basiert auf der Beobachtung, dass allein die Nähe eines Smartphones unsere kognitive Leistung schmälert. Denn unser Gehirn ist permanent damit beschäftigt, den Drang zum Griff nach dem digitalen Minicomputer zu unterdrücken – und das bindet Kapazitäten, die Konzentration wird stark beeinträchtigt.
Auch unser Gedächtnis leidet unter dem permanenten digitalen Konsum. Manfred Spitzer vertritt den Standpunkt, dass die übermäßige Nutzung von digitaler Technologie unser Kurzzeitgedächtnis beeinträchtigt. Der Neurowissenschaftler prägte dafür den Begriff "digitale Demenz". Stand die neue Technologie in ihren Anfangsjahren fast nur Erwachsenen zur Verfügung, haben heute auch Kinder flächendeckend Zugang zu Smartphones und Tablets. Rund 40 % der US-amerikanischen Kinder tragen bereits im Alter von zehn Jahren ihr eigenes Smartphone in der Tasche.
Diese frühere Digitalisierung besorgt die Forscher. Denn junge Gehirne sind schneller und stärker formbar. In jungen Jahren bilden sich Synapsen – die Verbindungen zwischen Nervenzellen – schneller und zahlreicher aus, während nicht benötigte Verbindungen leichter abgebaut werden. Wie also wirkt sich die ständige Präsenz von Smartphones auf die neuronale Entwicklung aus? Jonathan Haidt, Sozialpsychologe und Professor an der NYU Stern School of Business, spricht von der "großen Neuverkabelung der Kindheit". In seinem Bestseller Generation Angst beleuchtet er die Folgen dieser Entwicklung. Haidt argumentiert, dass die frühe intensive Nutzung von Smartphones, gepaart mit weniger Zeit zum Spielen, die Gehirnstruktur von Heranwachsenden grundlegend verändert.
Besonders kritisch bewertet Haidt den Einfluss auf den präfrontalen Cortex. Dieser Bereich im Gehirn ist für die Impulskontrolle und rationales Denken zuständig und wird durch Smartphones in seiner Entwicklung gestört. Seit 2012, so bemerkt Haidt, nehmen Depressionen, Angstzustände und Selbstverletzungen bei jungen Menschen drastisch zu. Zwischen 2010 und 2015 stieg die Selbstmordrate bei 10- bis 14-jährigen Mädchen um 167 % und bei Jungen um 92 %. Haidt macht dafür den Siegeszug der Smartphones verantwortlich.
Allerdings wurde sein Buch auch scharf kritisiert. Haidt wird vorgeworfen, dass er sich kleine, kaum aussagekräftige Studien herausgepickt hat und bloße Korrelationen mit Kausalität verwechselt. Seine Kritiker monieren außerdem, dass man die angesprochenen Krankheiten nicht so einfach auf eine einzige Ursache zurückführen kann. "Psychische Probleme sind komplex und haben oft mehrere Ursachen", warnt Heather Kirkorian, Entwicklungspsychologin und Professorin an der University of Wisconsin in Madison.
"Psychische Probleme sind komplex und haben oft mehrere Ursachen."
Die gesellschaftliche Hysterie um moralische Fragen ("moral panic") ist kein neues Phänomen. Schon oft reagierte die Gesellschaft übertrieben und irrational auf vermeintliche Bedrohungen: Mitte des 20. Jahrhunderts warnten Kritiker vor dem Fernsehen, in den 1940er-Jahren vor dem Radio und bereits im 18. Jahrhundert vor Romanen. Im antiken Griechenland äußerte Sokrates sogar Bedenken gegen das Schreiben – er befürchtete, Menschen könnten sich durch das Aufschreiben weniger merken.
Doch Smartphones und andere digitale Gadgets sind bei näherer Betrachtung eben doch anders als frühere Technologieinnovationen. Jenny Radesky, Assistenzprofessorin für Kinderheilkunde an der University of Michigan, hat beobachtet, dass sich die hohe Geschwindigkeit, mit der sich die Technologie weiterentwickelt, grundlegend von vorangegangenen Technologiewellen unterscheidet. "Ein Teil des Geschäftsmodells beruht darauf, sehr schnell groß zu werden und eine größtmögliche Anzahl von Nutzern zu erreichen", sagt sie. "Wir haben heute weniger Zeit, uns an eine neue Technologie anzupassen oder darauf zu warten, bis die Technologie sich an uns angepasst hat."
Die Medienhistorikerin Kirsten Drotner glaubt, der Zyklus der gesellschaftlichen Debatten um neue Technologien werde sich endlos wiederholen. Amy Orben, Psychologin an der University of Cambridge, nennt das den "Sisyphuszyklus der Technologiepanik": "Da jede neue Technologie unabhängig von der vorherigen untersucht wird, beschäftigen sich Psychologen routinemäßig mit den immer gleichen Fragen. Sie rollen ihren Felsbrocken den Berg hinauf, investieren Mühe, Zeit und Geld, um die Auswirkungen einer neuen Technologie zu verstehen, nur um dann den Felsbrocken wieder den Berg hinunterrollen zu lassen, sobald die neue Technologie eingeführt ist", erklärt Orben. "Die Psychologie steckt in diesem ewigen Kreislauf fest, weil das Muster gesellschaftlicher Panikwellen naturgemäß mit den Interessen von Politik, Gesellschaft und unserer eigenen Wissenschaft verflochten ist.
Die Forschung steckt zwar noch in den Kinderschuhen, doch die Bedenken, wie Smartphones unser Gehirn – und das unserer Kinder – beeinflussen, sind beunruhigend genug, um unser Verhältnis zu den smarten Begleitern grundlegend zu überdenken. Was können wir tun? In den 2010er-Jahren war Tristan Harris Produktmanager bei Google. Er beobachtete mit Sorge, wie die Produkte, an denen er mitarbeitete, die Aufmerksamkeit der Nutzer kaperten. 2013 verfasste er einen Aufruf an seine Kollegen, in dem er mehr Respekt vor den Kunden einforderte. Harris wollte auf diese Weise die Tech-Unternehmen in die Pflicht nehmen. Er hatte Erfolg: Seine Vorgesetzten machten ihn zum ethischen Berater für Produktdesign.
Im Jahr 2015 verließ Harris den Konzern. Er gründete die Bewegung "Time Well Spent". Sein Ziel: "Wir wollen Technologieunternehmen daran hindern, unseren Verstand zu kapern."
Harris entwickelte sich zu einem der größten Kritiker der Tech-Giganten, das Wall Street Journal nannte ihn "das Gewissen des Silicon Valley". Heute führt er das Center for Humane Technology (CHT), mit dem er Technologie und Menschheit besser miteinander in Einklang bringen will. Tech-Konzerne wie Apple und Google haben zumindest schon ein wenig auf ihn gehört. Heute können Nutzer ihre wöchentliche "Bildschirmzeit" überprüfen oder sich vom Smartphone Hinweise zum "digitalen Wohlbefinden" geben lassen. Aus Harris' Sicht durchaus vernünftige, wenngleich nur zaghafte erste Schritte auf einem langen Weg.
Wir können lernen, bewusster mit Smartphones umzugehen und unsere Aufmerksamkeit gezielter zu nutzen.
Offenbar muss die Politik eingreifen, wenn man die Sucht besser in den Griff bekommen will. Regierungen in Großbritannien und der EU gehen verstärkt gegen Anbieter von Social-Media-Plattformen und Smartphones vor. Die Unternehmen müssen mit hohen Strafen rechnen, wenn sie illegale Inhalte oder Desinformation nicht unterbinden. Auch das gezielte Ausspielen von Werbung an Kinder auf Basis ihrer persönlichen Daten kann Sanktionen nach sich ziehen. Zusätzlich müssen die Anbieter nun Studien zur psychischen Gesundheit von Kindern auf ihren Plattformen offenlegen.
In den Vereinigten Staaten überlassen Gesetzgeber den Schutz der Kinder weitgehend den Eltern. "Eltern tragen heute die Hauptlast im Kampf gegen milliardenschwere Anbieter – das ist problematisch", kritisiert Kirkorian. "Die Politik müsste eigentlich eingreifen, besonders wenn es um Privatsphäre und manipulatives Design geht. Denken Sie nur an die vielen Geschäftsbedingungen und Datenschutzregeln im Internet, denen sehr viele Nutzer oft zustimmen, ohne sich dessen überhaupt bewusst zu sein."
Seit der Einführung des iPhones lässt sich die digitale Revolution nicht mehr aufhalten. Smartphones werden unseren Alltag weiterhin prägen. Doch wir können lernen, bewusster mit ihnen umzugehen und unsere Aufmerksamkeit neu zu fokussieren. Die genauen Auswirkungen auf unser Gehirn kennen wir zwar noch nicht. Aber eine gelegentliche digitale Auszeit tut jedem gut.
![{[downloads[language].preview]}](https://www.rolandberger.com/publications/publication_image/ta44_de_cover_download_preview.jpg)
Die aktuelle Think:Act-Ausgabe wirft einen frischen Blick auf die Business-Konzepte der letzten Jahrzehnte – und ihre Bedeutung für die kommenden 20 Jahre.




