Reise in die Zukunft
![{[downloads[language].preview]}](https://www.rolandberger.com/publications/publication_image/ta39_de_covers_1_final_download_preview.jpg)
Was wäre, wenn wir in die Zukunft reisen könnten, um das Jahr 2050 zu sehen und noch mehr? Das Playbook der neuen Think:Act wagt den Versuch, nach vorne zu schauen!

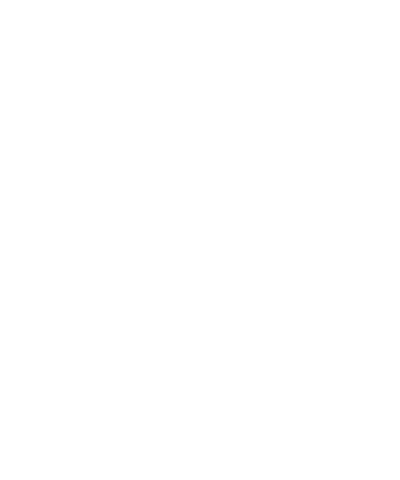
von Farah Nayeri
Illustrationen von Alberto Miranda
Der Kapitalismus ist eine Effizienzmaschine. Verteilungsfragen aber kann der Markt nicht lösen. Seit der Finanzkrise stellen Ökonomen und Wirtschaftsführer die Systemfrage: Ist der Kapitalismus noch die geeignete Wirtschaftsordnung für das 21. Jahrhundert?
Die Zahlen sprechen eine klare Sprache: Eine kleine Gruppe sehr reicher Menschen kontrolliert inzwischen den größten Teil des weltweiten Wohlstands. Die Ungleichheit der Einkommen gehört zwar seit jeher zum Kapitalismus. Doch stellt sich heute zunehmend die Frage, ob die hohen Einkommens- und Vermögensunterschiede die gesellschaftliche Stabilität gefährden und auf Dauer die Demokratie aushöhlen. Sind die Paradigmen der Marktwirtschaftler und Ordoliberalen heute noch zeitgemäß – oder gehört der Kapitalismus enger an die Leine?
Die kapitalistische Gesellschaftsordnung beruht auf Gewinnmaximierung und seit einigen Jahrzehnten verstärkt auch auf der Förderung des Aktionärswohls, des Shareholder Value. Genau darauf haben sich Investoren zuletzt konzentriert. Profite und die Interessen der Aktionäre standen im Mittelpunkt. Die Politik hielt sich zurück: Besteuerung und Regulierung wurden verschlankt, damit Unternehmen und Finanzmärkte ungestört den Wohlstand mehren konnten.
Doch die Zeiten haben sich geändert. Seit der Finanzkrise in den Jahren ab 2008 wird der Kapitalismus mit wachsender Dringlichkeit infrage gestellt. Selbst die Börsenlegende Warren Buffett forderte mehrfach, sehr vermögende Privatpersonen höher zu besteuern. Der Multimilliardär konnte sich den Hinweis nicht verkneifen, dass seine Sekretärin einen höheren Steuersatz zahlt als er. Sein Milliardärskollege Bill Gates räumte ein, dass Unternehmen lieber langfristige Interessen verfolgen sollten, als nur auf die Quartalszahlen zu schielen. Der Microsoft-Gründer bevorzugt heute eine Welt, in der Exzesse des Kapitalismus gezügelt werden sollten.
"Ich möchte die Unternehmen dieses Landes, die Fabriken, die Büros in demokratische Gemeinschaften umwandeln."
Überall werden die Stimmen lauter, die ein humaneres Wirtschaftssystem fordern. Nach Jahrzehnten des US-amerikanisch dominierten Laissez-faire-Kapitalismus schält sich dabei ein Konsens heraus, der auf weniger Macht für Märkte und Aktionäre, dafür aber auf mehr Rechte und Teilhabe für Arbeitnehmer setzt. Viele halten die Zeit für eine Revitalisierung von Elementen einer einstmals klassischen sozialistischen Wirtschaftspolitik für gekommen – zum Beispiel höhere Steuern für Reiche, stärker regulierte Märkte und eine egalitärere Verteilung des erarbeiteten Wohlstands.
Besonders ausgeprägt ist die Kapitalismuskritik traditionell in Europa. Der französische Ökonom Thomas Piketty identifiziert in seinem Weltbestseller Das Kapital im 21. Jahrhundert eine hohe Vermögenskonzentration als Gefahr für die Demokratie. Mariana Mazzucato, Ökonomie-Professorin am University College London, verweist auf Alternativen zum angelsächsischen Modell. Deutschland mit seiner Sozialen Marktwirtschaft, skandinavische Länder und Japan gehen andere Wege. Kurzfristige Gewinnmaximierung steht hier weniger im Vordergrund, Vorstandsgehälter halten sich überwiegend im Rahmen, Unternehmen müssen sich gegenüber einer größeren Gruppe von Stakeholdern verantworten. Dazu zählen oft auch die Arbeitnehmer, die in Deutschland besser organisiert sind als in den USA.
Einige der größten Kritiker des US-Kapitalismus finden sich jedoch in den USA selbst. Der emeritierte Professor Richard Wolff zum Beispiel, laut New York Times Magazine "Amerikas prominentester marxistischer Ökonom", lehrte bis 2008 an der University of Massachusetts in Amherst Wirtschaftswissenschaften. Heute hat Wolff eine Gastprofessur für Internationale Politik an der New School University in New York inne.
In der überwiegend marktliberalen Ökonomenzunft war er lange Zeit ein Außenseiter. Jetzt nähern sich seine Ansichten jedes Jahr ein bisschen mehr dem sich wandelnden Zeitgeist an. "Ich habe in den letzten sechs Jahren mehr öffentliche Reden gehalten und mehr Einladungen von den allerbesten Adressen erhalten als in den 50 Jahren davor", sagt Wolff. Der Sohn eines Stahlarbeiters, geboren in Youngstown, Ohio, erlebte eine Zeit, in der die Fabriken noch die Lebensadern der Stadt waren. Hier wurde der Stahl produziert, mit dem in Detroit General Motors und Co. Autos produzierten, weltweit ein Symbol für den Nachkriegswohlstand und die Stärke der neuen Supermacht USA. Wolff erinnert sich an das seinerzeit vorherrschende Ethos: "Wenn du hart arbeitest und dich anstrengst, wirst du einen guten Job bekommen – und genug Geld verdienen, um dir all die Dinge leisten zu können, die dich glücklich machen." Doch in den vergangenen 40 Jahren sei der Wohlstand der Durchschnittsamerikaner immer weiter gesunken, konstatiert Wolff. Und das in einem der reichsten Länder der Welt.
Die Gründe sind bekannt. Seit Jahrzehnten verlagern US-Unternehmen Fabriken nach China, Indien oder Brasilien. Um ihre Profite zu steigern, automatisieren sie Produktionsabläufe und setzen heute immer mehr auf die Digitalisierung und Künstliche Intelligenz. Amerikanische Arbeiter werden in der Produktion immer weniger gebraucht. "Das ist ein Schlag ins Gesicht der Arbeiterklasse", meint der Wirtschaftsforscher.
Die Corona-Pandemie wirkte wie ein Katalysator. Zwischen Anfang 2020 und Mitte 2021 verloren Millionen Menschen in den USA ihren Arbeitsplatz. Das war ein "schrecklicher Absturz", so Wolff, der nur von der Großen Depression in den 1930er-Jahren übertroffen worden sei. Zusammen mit dem politischen Missmanagement der Pandemie, der Rückkehr der Inflation und steigenden Zinsen ergebe sich eine Situation, die womöglich zu einem explosiven sozialen Gemisch führe. "Ich glaube, wir haben den Höhepunkt überschritten. Das amerikanische Imperium ist im Niedergang begriffen", prophezeit der Ökonom.
"Heute wird es immer schwieriger, die zerstörerischen Kräfte eines nur auf den Profit ausgerichteten Managementstils zu ignorieren."
Sein Vorschlag? Mehr Demokratie im Aktienrecht. Heute halten 10 % der Aktionäre 80 % der Aktien. Jede Aktie verbrieft eine Stimme in der Hauptversammlung, Großaktionäre haben so einen sehr großen Einfluss auf Unternehmensentscheidungen, argumentiert Wolff. Seiner Ansicht nach sollte nicht jede Aktie eine Stimme ermöglichen, sondern jeder Aktionär eine Stimme haben. "Ich möchte die Unternehmen dieses Landes, die Fabriken, die Büros, in demokratische Gemeinschaften umwandeln", sagt er. "Ich glaube, dass wir so radikal andere Entscheidungen im Wirtschaftsleben sehen würden."
Wie kam es dazu, dass US-Unternehmen die Interessen der Aktionäre über alles stellten? Die Grundlage legte in den 1970er-Jahren eine Gruppe von liberalen US-Ökonomen. Aus ihrer Sicht lag die soziale Verantwortung von Unternehmen allein darin, ihren Gewinn zu maximieren. Daraus entwickelte sich der Shareholder-Value-Gedanke. Der Mann, der diese Philosophie zum Mantra machte, war Jack Welch . Der Manager war von 1981 bis 2001 Vorstandsvorsitzender von General Electric (GE) und kassierte bei seinem Ausscheiden eine Abfindung von mehr als 400 Millionen US-Dollar.
In seinem Buch über Welch, The Man Who Broke Capitalism, beschreibt der New York Times-Journalist David Gelles den 2020 verstorbenen Manager als machthungrig und geldgierig. Und als "ideologischen Revolutionär", der Gewinnmaximierung rücksichtslos über alles stellte. Unter "Neutronen-Jack" entwickelte sich GE laut Gelles von einem anerkannten Industriegiganten, geschätzt für hochwertige Technologieerzeugnisse und vorbildliche Geschäftspraktiken, zu einem multinationalen Mischkonzern, der nur noch auf kurzfristige Gewinne aus war und dem Wohl seiner Mitarbeiter keine Beachtung mehr schenkte. Welch, der in seiner Amtszeit mehr als 100.000 Mitarbeiter feuerte, wurde von der Zeitschrift Fortune zum "Manager des Jahrhunderts" gekürt – und Vorbild für eine ganze Generation.
Heute werde es jedoch immer schwieriger, die zerstörerische Kraft eines solchen Managementstils zu ignorieren, meint Gelles. Besonders für Arbeitnehmer seien die Folgen verheerend. 1953 lagen die Dinge bei General Electric noch ganz anders. Im Jahresabschluss berichtete die Geschäftsführung mit Stolz von guten Geschäften und der größten Lohnsumme aller Zeiten. Die Botschaft an Investoren und Aktionäre war deutlich: Seht her, wir können unsere Mitarbeiter ordentlich bezahlen; und das ist eine gute Sache, die auch Investoren "eine angemessene Rendite" einbringt. Eine andere Perspektive als heute, der Gelles einiges abgewinnen kann. Unternehmen sollten sich auf nachhaltige Gewinne konzentrieren und ihren Aktionären erklären, dass es im Unternehmensinteresse ist, sich anständig um seine Mitarbeiter zu kümmern.
Von einer Krise des Kapitalismus will Branko Milanović jedoch nichts hören. Der aus Serbien stammende US-Ökonom lehrt an der City University of New York und forscht seit vielen Jahren zum Thema soziale Ungleichheit. Sein Argument: Da weder in Unternehmen noch in den Regierungen der westlichen Welt ernsthaftes Bestreben zur Reform des Systems zu erkennen sei, könne von einer Krise des Kapitalismus keine Rede sein. "Es ist mindestens zehn Jahre her, dass Ungleichheit zu einem öffentlich breit diskutierten Thema wurde", sagt er. "Aber es folgten keine politischen Maßnahmen." Milanović gesteht zwar zu, dass erhebliche öffentliche Transferzahlungen während der Pandemie die Ungleichheit zeitweilig etwas gemildert haben. "Aber das war nur ein Einmaleffekt in einer absoluten Ausnahmesituation."
Der frühere Chefökonom der Forschungsabteilung bei der Weltbank hat zwei Gründe für die beharrliche soziale Ungleichheit identifiziert. Erstens die geringe soziale Mobilität, auch in der Mittelschicht. Reiche Familien gäben ihre Privilegien an ihre Kinder weiter, über eine erstklassige Schulbildung und gute Beziehungen. Die nächste Generation profitiert ebenfalls von hohen Einkommen, den Erbschaften und dem sozialen Status. Kinder weniger betuchter Eltern genössen diese Vorteile nicht, ihr Weg nach oben sei viel beschwerlicher.
Die zweite Ursache ist laut Milanović, dass der politische Diskurs von einer Plutokratie beherrscht werde. Geld sei überall: in der Politik, in den Medien, in der Wissenschaft. Das erlaube es Superreichen, politische Prozesse und Narrative zu kontrollieren. Jeff Bezos, einer der reichsten Männer der Welt, besitzt zum Beispiel das US-Leitmedium Washington Post. Elon Musk hat Twitter gekauft. "Das ist unglaublich, aber kaum einer redet darüber", kritisiert Milanović. Wolff warnt die größten Profiteure des Kapitalismus jedoch vor einem ökonomischen Selbstmord: "Wir können nicht einfach so weitermachen. Sonst töten wir die Gans, die die goldenen Eier legt."
![{[downloads[language].preview]}](https://www.rolandberger.com/publications/publication_image/ta39_de_covers_1_final_download_preview.jpg)
Was wäre, wenn wir in die Zukunft reisen könnten, um das Jahr 2050 zu sehen und noch mehr? Das Playbook der neuen Think:Act wagt den Versuch, nach vorne zu schauen!




