In Dekaden denken
![{[downloads[language].preview]}](https://www.rolandberger.com/publications/publication_image/ta44_de_cover_download_preview.jpg)
Die aktuelle Think:Act-Ausgabe wirft einen frischen Blick auf die Business-Konzepte der letzten Jahrzehnte – und ihre Bedeutung für die kommenden 20 Jahre.

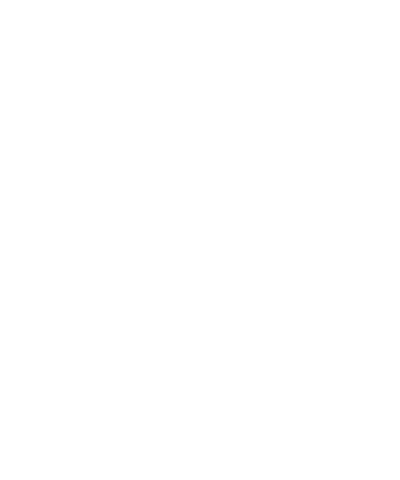
von Margaret Heffernan
Illustrationen von Jan Robert Dünnweller
Margaret Heffernan unterstützt Firmen seit Jahrzehnten beim Blick nach vorn. Ihre Lektion: In unsicheren Zeiten muss man sich schnell anpassen können.
Bertrand Russel liebte es, folgende kleine Geschichte zu erzählen: Jeden Tag ging die Sonne auf. Das Huhn erwachte, ging nach draußen, gackerte und bekam Futter. Weil sich dieses Muster Tag für Tag wiederholte, gab es für das Huhn keinen Grund, etwas anderes zu erwarten. Und doch ging eines Tages die Sonne auf – das Huhn trippelte nach draußen zum Gackern und der Bauer drehte ihm den Hals um. Wir Menschen, so unterstellt der britische Philosoph, sind im Grunde wie das Huhn. Wir gehen einfach davon aus, dass sich Vergangenes wiederholen wird. Aber gibt es einen Grund, an das zu glauben, was Russell die "Gleichförmigkeit der Natur" nennt? Das Beste, auf das wir hoffen können, sind Wahrscheinlichkeiten, nicht Gewissheiten.
Das ist eine harte Lektion. Doch wenn wir darüber nachdenken, wird schnell klar, wie viel im Leben ungewiss ist: ob wir den Bus oder den Flieger erwischen, eine Hypothek abbezahlen können, ob das Unternehmen weiter wächst oder das Leben auf der Erde noch lange fortbestehen wird. Die Pandemie und die Kriege in der Ukraine und im Nahen Osten haben uns für die Unberechenbarkeit des Lebens sensibler gemacht – aber nicht gezeigt, wie wir damit umgehen sollen.
Margaret Heffernan ist ehemalige Geschäftsführerin von fünf Unternehmen und ordentliche Professorin an der University of Bath. Sie hat mehrere Bücher veröffentlicht. Als Dozentin des Responsible Leadership Programme beim Forward Institute berät sie Führungskräfte globaler Konzerne.
Manager setzen seit der industriellen Revolution auf das Modell des "dreibeinigen Hockers" aus Prognose, Planung und Ausführung. Dabei hoffen die Führungskräfte auf eine immer höhere Genauigkeit in allen drei Phasen. Während die Just-in-time-Planung für nur noch hauchdünne Zeitspielräume sorgte und die Ausführung effizienter wurde, wurden die Prognosen nicht besser. Selbst bei sehr sorgfältigem Vorgehen, das Vorhersagen mit einem Enddatum und Wahrscheinlichkeiten angesichts neuer Informationen aus vielfältigen Quellen versieht, ist es bestenfalls möglich, etwa 400 Tage in die Zukunft zu blicken. Bei einem weniger strikten Prognoseansatz sind es 150 Tage. Und auch wenn man unvorhersehbare Ereignisse wie Kriege, Epidemien oder Finanzkrisen einkalkuliert, wissen wir immer noch nicht, wo und wann sie beginnen und was sie auslösen wird. Die unsichere Weltlage, in der wir leben, lässt Unternehmenslenker ratloser zurück als Russells Huhn.
"Anpassungsfähigkeit – nicht Kontrolle! – ist der entscheidende Faktor, um mit Unsicherheit besser zurechtzukommen."
Viele sehnen sich nach einer Rückkehr zur Normalität, hoffen auf wundersame Veränderungen durch eine Wahl, einen neuen CEO oder eine bahnbrechende Technologie. Andere bauen auf vermeintlich ewige Wahrheiten wie Effizienz, Restrukturierung, Kostensenkung und Kurzfristdenken. Die Mehrheit der Manager nimmt Unternehmen nach wie vor als Maschinen wahr und nicht als das, was schon das Wort nahelegt: als lebende Organismen. In ihrem Streben nach Kontrolle sehen nur wenige die Notwendigkeit für neue Denkansätze.
Wie sollen wir auf neue Umstände reagieren? Zunächst müssen wir die Realität der Gegenwart anerkennen. Wer sich eingesteht, dass er die Zukunft nicht vorhersehen kann, plant großzügige Handlungsspielräume ein. Ein Beispiel: Am Eröffnungstag der Olympischen Spiele 2024 in Paris war es unmöglich, mit dem Zug von London nach Paris zu reisen und pünktlich anzukommen, ohne vorher lange Pausen einzuplanen. Das war zwar ineffizient, gab mir aber die Flexibilität, meine Reiseroute zu ändern. Anpassungsfähigkeit – nicht Kontrolle! – ist der entscheidende Faktor, um mit Unsicherheit besser zurechtzukommen.
In der alten Welt wurde auf Effizienz getrimmt, eine zunehmend komplexere Weltlage dagegen verlangt vor allem mehr Flexibilität. Das ist der Grund dafür, warum so viele Unternehmen inzwischen auf "Just- in-Case" statt "Just-in-Time" setzen. Nur wer sich sehr sicher ist, kann genau planen. Für alle anderen gilt es, flexibel zu bleiben.
Da wir nicht wissen, was die Zukunft bringt, müssen wir permanent experimentieren. Fragen Sie sich bei aufkommenden Problemen, wie Prozesse besser funktionieren könnten. Dann probieren Sie es aus! Jedes Experiment wird neue Aspekte zum Vorschein bringen, die Sie bisher übersehen haben. Zum Beispiel bei Buurtzorg: Das niederländische Pflegeunternehmen hat seine ambulante Krankenpflege drastisch verbessert, indem es einen Großteil seiner Abläufe im Backoffice automatisierte und zugleich Pflegekräfte von starren Zeitplänen befreite. Die neue, sehr simple Anweisung: "Tue einfach das Beste für die Patienten" senkte die Kosten der Krankenpflege um 33 %. Jos de Blok, Initiator des Experiments, antwortete auf die Frage, was ihn am meisten überrascht habe: Er habe sich nicht vorstellen können, dass eine derart große Verbesserung so einfach möglich sei.
"Selbstständiges Denken ist nicht die Stärke der jungen Generation. Das muss sich ändern."
In der Welt des Managements setzt man heute wieder mehr auf das Planen von mehreren möglichen Zukunftsszenarien. Mit großen Mengen harter und weicher Daten entwirft man dabei drei oder vier plausible Möglichkeiten, wie die Zukunft aussehen könnte. Die Frage für jedes Szenario lautet dann: Wenn das Wirklichkeit würde, was würden wir uns wünschen, das wir heute getan hätten? So generiert man jede Menge Handlungsoptionen. Doch viele sind nicht bereit, sich auf die intensiven Debatten einzulassen, die das mit sich bringt. Gerade Managern fällt das oft schwer. Computerspieler schneiden da besser ab. Warum? Weil es beim Gamen darum geht, mit Optionen zu spielen. Der kreative Umgang damit, was passieren könnte, macht das Spielvergnügen aus.
Andy Haldane, früherer Chefvolkswirt der Bank of England, ist überzeugt, dass unsichere Zeiten mehr Risikobereitschaft erfordern. Wenn Politik und Manager aber gezielt Risiken vermeiden wollen, erreichen sie genau das Gegenteil: Die Risiken werden größer. Auch das spricht dafür, Problemen zuvorzukommen und sich nicht von Details ablenken zu lassen.
Dafür braucht man kreative Köpfe, die stets neue Ideen entwickeln und nicht in Schablonen denken. Viele Führungskräfte kritisieren, dass es ihren Mitarbeitern an kreativem und kritischem Denken mangelt. Und das stimmt. In der Schule und später im Beruf wird mehr Wert auf richtige Antworten als auf originelle Gedanken gelegt. Selbstständiges Denken ist nicht die Stärke der jungen Generation. Das muss sich ändern.
Vor rund zehn Jahren wurde der Regierung von Singapur klar, dass reines Auswendiglernen an den Schulen nicht mehr ausreicht, um den Wohlstand der Zukunft zu sichern. Deshalb setzt man seit ein paar Jahren auf mehr kooperatives und kreatives Arbeiten. Eine solche Weltsicht sucht man im europäischen, britischen oder amerikanischen Bildungssystem vergebens. Dort werden Geisteswissenschaften an den Rand gedrängt. Stattdessen produziert man gehorsame Absolventen, die das selbstständige Denken verlernen. Danach müssen sie automatisierte Bewerbungsverfahren durchlaufen. Abweichungen von der Norm werden aussortiert. Die Bewerber, die schließlich einen der begehrten Jobs ergattern, werden ihren Vorgesetzten kaum widersprechen – und das in einer Zeit, in der Unternehmen die Originalität der Beschäftigten mehr brauchen denn je.
"In Zeiten der Ungewissheit werden wir anfälliger, wenn wir uns auf nur einen Prozess, eine Denkweise oder eine Person allein verlassen."
Der Gedanke mag verführerisch sein, dass Künstliche Intelligenz (KI) in Zukunft viele Probleme lösen wird. Doch Vorsicht vor vermeintlichen Heilsbringern und ihren Missionaren! Selbst wenn KI und helfen kann, müssen Führungskräfte auch in Zukunft Entscheidungen selbst fallen. Das wird ihnen keine Maschine abnehmen. Eine gute Entscheidung basiert auf einer soliden Grundlage an Informationen. Sie muss so aufbereitet sein, dass sie auch von denjenigen, die ihr nicht vollständig zustimmen, akzeptiert werden kann. Ihre Legitimität ergibt sich aus den an ihrer Vorbereitung beteiligten Personen und deren Kompetenz. All diese Kriterien sind in Bezug auf eine KI kaum anwendbar. Das bedeutet zwar nicht, dass ihr Einsatz generell unzulässig ist, aber es bedeutet eben, dass die Vorschläge einer KI sorgfältig geprüft und diskutiert werden müssen. Und es bedeutet, dass man sich über mögliche Auswirkungen sehr klar werden muss.
Im Wirtschaftsleben geht es trotz allen irreführenden Fachjargons immer um das Leben an sich. Deshalb kann eine biologische Sichtweise vielleicht hilfreich sein. Unternehmen, die erfolgreich sein wollen, müssen die Anpassungsfähigkeit eines menschlichen Körpers kopieren, der in einem homöostatischen Modus (Balance zwischen Energieerzeugung und -verbrauch, Just-in-Time), einem anabolen Modus (Aufbau von mehr Ressourcen als nötig, Just-in-Case) und einem katabolen Modus gedeihen kann, das heißt mit der Fähigkeit, sofort zu reagieren und Ressourcen schneller zu verbrauchen, als sie ersetzt werden können.
Zusätzlich profitieren Unternehmen von einer diversen Belegschaft, auch sie erhöht ihre Anpassungsfähigkeit. Entscheidend ist, dass man weiß, wann man was einsetzt. Wir brauchen mehr Optionen und mehr Fantasie, nicht weniger. Wenn wir das nicht begreifen, bleiben wir zurück – verängstigt wie Russells Huhn, gefangen im ewig Gleichen und unfähig, uns an neue Umstände anzupassen, die wir nicht haben kommen sehen.
![{[downloads[language].preview]}](https://www.rolandberger.com/publications/publication_image/ta44_de_cover_download_preview.jpg)
Die aktuelle Think:Act-Ausgabe wirft einen frischen Blick auf die Business-Konzepte der letzten Jahrzehnte – und ihre Bedeutung für die kommenden 20 Jahre.


